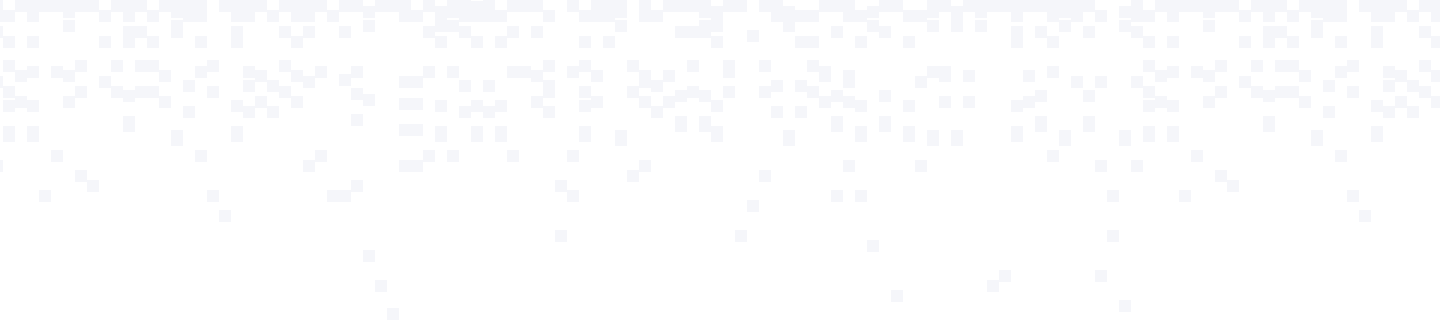ZUSAMMENFASSUNG: Seit den 1920er Jahren bis in die Gegenwart hat die palästinensische Führung zu Unterstützung von muslimischer, arabischer und internationaler Seite aufgerufen, um ihre Sache an die Spitze von aufkommenden Strömungen und Bewegungen zu setzen. Die Internationalisierung diente auch als Mittel zur Nationalisierung der palästinensischen Massen. Aber im Zuge dessen haben die Palästinenser die Kontrolle immer wieder den äußeren Kräften und Interessen überlassen – von arabischen, panarabischen und revolutionären Nationalisten, bis hin zur rot-grünen Anti-Globalisierungsallianz von heute –, die den palästinensischen Nationalismus für ihre eigenen Zwecke manipulierten. Die eigentliche Ursache für diese Entwicklung liegt im schwachen palästinensischen Nationalbewusstsein.
Die Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) - Bewegung stellt sich als Graswurzelbewegung der palästinensischen Bemühungen zur Mobilisierung einer globalen Unterstützung gegen Israel dar. In Wahrheit ist sie aber eine lose koordinierte Bemühung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), der Muslimbruderschaft und der globalen Linken, die vorgibt, im Namen des palästinensischen Volkes zu sprechen. Im amerikanischen Jargon nennt man das „Astroturf” – eine künstliche Graswurzelbewegung.
Dieser jüngste Durchlauf der Bemühungen der palästinensischen Führungsschicht, ihren Konflikt mit den Juden, dem Zionismus und Israel zu internationalisieren, ist für ihre jahrhundertelange Bestrebung, die internationale Unterstützung anstelle und als Mittel zu einer Nationalisierung der palästinensischen Massen zu mobilisieren, emblematisch. Dabei verlor die palästinensische Führung jedoch die Kontrolle über diese Prozesse, die teilweise durch die politischen Bedürfnisse und den inhärenten Antisemitismus der arabischen und islamischen Länder sowie durch die globale Geopolitik angetrieben wurden.
Eine Internationalisierung war bereits in den 1920er Jahren, im frühen Stadium der pan-muslimischen und antikolonialen Politik, erkennbar. Auf die neu entstandene Narrative vom Jerusalemer Mufti Amin al-Husseini, dass die „al-Aqsa in Gefahr“ sei, folgte eine globale Spendenkampagne zur Restaurierung der Moscheen auf dem Tempelberg, durch die die angeblich von den jüdischen Übergriffen ausgehende Bedrohung noch hervorgehoben wurde. Als Präsident des Obersten Islamischen Rats inszenierte der Mufti die Unruhen an der Klagemauer im Jahr 1929 und eine islamische Konferenz, die 1931 in Jerusalem stattfand.
Der zu Beginn der Massengewalt von 1936-1939 vom Mufti inszenierte Generalstreik beinhaltete auch die Forderung nach einer arabischen Intervention. Obwohl deren Eintreten eher unwahrscheinlich war, waren die britischen Behörden von dieser Aussicht verunsichert, was die Verhängung des Kriegsrechts verhinderte, die Rebellen rettete und den Konflikt verlängerte. Kritik seitens Muhammad Ali Jinnah und seiner All-indischen Muslimliga hatte großen Einfluss auf Großbritannien.
Obwohl die Peel-Kommission, die infolge der palästinensischen Gewalt eingerichtet worden war, vorgeschlagen hatte, das Völkerbundsmandat zugunsten der Errichtung einer jüdischen nationalen Heimstatt in Palästina aufzugeben und das Land in zwei Staaten zu teilen – einen jüdischen und einen arabischen Staat – wurde die Idee vom Mufti strikt abgelehnt, der noch mehr zu tobender Gewalt aufrief. Die Bludan-Konferenz von 1937, an der so führende arabische nationalistische Gestalten wie Riad as-Solh von Libanon und Muhammad Ali Alluba Pasha aus Ägypten teilnahmen, war ein Ergebnis davon. Die Konferenz forderte einen Boykott gegen alle „jüdischen Güter und Aktivitäten“ sowie gegen die von Großbritannien. Darauf folgten eine zweite, geheime Konferenz von arabischen Nationalisten in Damaskus sowie weitere Konferenzen in Kairo und Brüssel im Jahr 1938. Bei all diesen Anlässen wurde die Palästinenserfrage viel diskutiert, aber sie diente vor allem als Instrument für andere nationalistische Bewegungen. Das Thema Palästina war sofort zentral und nominell.
Im Zeitalter des Panarabismus gab es ein ähnliches Zusammenspiel zwischen der Palästinafrage und den Bedürfnissen der arabischen Staaten. Bei der Gründung der Arabischen Liga im Jahr 1945 wurde das palästinensische Problem formell in den Mittelpunkt gestellt. Eine ihrer ersten Handlungen waren Boykotte gegen die Juden in arabischen Ländern, wo diese seit Jahrtausenden lebten. Eine weitere Bludan-Konferenz im Jahr 1946 enthielt einen Aufruf des Arabischen Hohen Komitees des Mufti an die arabischen Staaten, eine vereinte Armee zu bilden, um einen jüdischen Staat zu verhindern. Aber die arabischen Führer zögerten, bis sie durch den 1947 ausgebrochenen Bürgerkrieg zwischen den Palästinensern und Juden dazu gezwungen wurden. Es folgten eine militärische Intervention, Katastrophen, Schande und Enteignung.
Während der Phase des revolutionären Nationalismus stand hinter der Gründung der PLO im Jahr 1964 durch die Arabische Liga die palästinensische Bestrebung, den Konflikt durch eine Beteiligung von arabischen und muslimischen Verbündeten auszuweiten. Aber die treibende Kraft hinter der Gründung der Organisation war der ägyptische Präsident Gamal Abdul Nasser. Und es war der KGB, der nach 1967 Jassir Arafat und seine Fatah-Bewegung in die Führung der PLO manövrierte. Die Befreiung von Palästina durch „bewaffneten Kampf“ – der Euphemismus der PLO für Terrorismus (und in geringerem Maße für Guerillakrieg) – symbolisierte eine Form von magischem Denken, aber die „romantische“ Vorstellung eines revolutionären palästinensischen Nationalismus, der von externen Kräften geleitet und finanziert wird, prägte die palästinensische Nation und tat der Koexistenz mit Israel jahrzehntelang einen Abbruch.
Die Position der PLO während der Zeit der anti-imperialen und antikolonialen Kriegsführung war die einer grundlegenden Befreiungsbewegung. Sie verbündete sich mit dem Afrikanischen Nationalkongress, der SWAPO, den Sandinisten und einer Reihe anderer „indigener“ Bewegungen. Aber hinter diesen standen die Sowjetunion und ihre Satellitenländer, die für Ausbildung, Finanzierung und Unterstützung sorgten, und denen es im Wesentlichen um Stellvertreterkriege gegen die USA und ihre Verbündeten ging. Die palästinensische Sache stand rasch für die meisten Bewegungen im Mittelpunkt (ausgenommen Südafrika), während rund um Arafat und seinen engeren Kreis eine Kleptokratie entstand. Internationaler Terrorismus und blutige Kriege niedriger Intensität waren die primären Ergebnisse davon. Die West Bank und die Palästinenser in der Diaspora fielen auf eine nachgeordnete Stellung zurück, sogar noch nach den Oslo-Abkommen.
Eine weitere direkte Variante des Internationalisierungsprogramms war die Kooptation im System der Vereinten Nationen (UN), dem Herzstück des liberalen Internationalismus der Nachkriegszeit. Mit der Welle der Dritten-Welt-Ideologie, des Antiimperialismus und Antikolonialismus (Strömungen, die zum Teil von der Sowjetunion unterstützt wurden) schwimmend, und mit ausdrücklicher Unterstützung seitens der arabischen, muslimischen und kommunistischen Staaten, wurde die „Palästinafrage“ ab Mitte der 1960er Jahre zu einem zentralen Thema im UN-System.
Die UNRWA ist natürlich seit 1950 die Gesundheits-, Erziehungs- und Wohlfahrtsorganisation der Palästinenser, während zahlreiche andere Teile des UN-Systems moralische, rechtliche und praktische Unterstützung bieten. Die Unterstützung für die Palästinenser durch die Generalversammlung begann 1969 und 1970 mit der Resolution 2535, die „die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes bekräftigt“, und mit der Resolution 2672, in der gleichfalls von den palästinensischen „unveräußerlichen Rechten“ die Rede ist und durch die die „Palästinafrage“ auf die Tagesordnung der Generalversammlung von 1974 kam (wo sie bis heute geblieben ist).
Andere UN-Resolutionen sorgten für praktische Unterstützung: in der Resolution 3375 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation als „Vertreterin des palästinensischen Volkes“ anerkannt, mit der Resolution 3376 wurde das „Komitee zur Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes“ errichtet und die Resolution 3379 „bestimmt[e], dass Zionismus eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung ist“. Alle drei wurden 1975 am selben Tag verabschiedet. Durch die Resolution 3240 vom Jahr 1977 wurde die Sonderabteilung für die Rechte der Palästinenser im UN-Sekretariat ins Leben gerufen sowie der „Internationale Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk“. Umbenannt in „Abteilung für die Rechte der Palästinenser“, unterstützt diese Abteilung nun das „Komitee für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes“ durch internationale Treffen, Zusammenarbeit mit NGOs, Studien und Bulletins sowie Trainingsprogramme.
Unterstützung für die palästinensische Sache wird noch von mehr als 50 anderen Komitees oder Büros geboten, darunter der Sonderkoordinator für den Nahostfriedensprozess, der Sonderkoordinator in den besetzten Gebieten, Rückzugsbeobachter und Waffenstillstandskräfte, der Menschenrechtsausschuss und der Menschenrechtsrat, das Büro zur Koordinierung der humanitären Hilfe, der Jerusalem-Ausschuss, das Register der Vereinten Nationen für die Erfassung der durch den Bau der Mauer verursachten Schäden, der Sonderausschuss zur Untersuchung israelischer Praktiken, Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten und die Vermittlungskommission für Palästina, die 1948 gegründet wurde. Das absurde Ausmaß, in dem Palästina die UN dominiert, wird durch den vierten Ausschuss verdeutlicht, der sich mit „einer Vielzahl von Themen, die Entkolonialisierung, palästinensische Flüchtlinge und Menschenrechte, Friedenssicherung, Minenräumung, Weltraum, öffentliche Information, Atomstrahlung und die Universität für Frieden mit einschließen“ befasst.
Und schließlich, im Zeitalter der linkslastigen Anti-Globalisierung, gibt es auch noch die BDS-Bewegung. Sie ist angeblich ein Produkt der UN-Weltkonferenz über Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, die 2001 in Durban stattfand, der palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) von 2004 und des „Aufrufs der Palästinensischen Zivilgesellschaft zu BDS“ im Jahr 2005. Aber die wahren Ursprünge der Bewegung reichen mindestens bis in die 1940er Jahre zurück. Der Boykott der Arabischen Liga und der amerikanisch-arabische Antizionismus sind wichtige Grundlagen, ebenso wie die Beiträge des Generalverbandes der Palästinensischen Studenten (1959 in Kairo gegründet, damit Palästina zum Schwerpunkt des arabischen Studentenlebens im Nahen Osten und dann in Europa wird), aus dem dann im Jahr 2000 die Studentenorganisation „Studenten für Gerechtigkeit in Palästina“ hervorging.
Aber auch die Beiträge der Neuen Linken und insbesondere der jüdischen Linken der späten 1960er und 1970er Jahre (die teilweise vom KGB und der PLO genutzt wurden) und des amerikanischen Muslimbruderschaftsnetzwerks, von dem amerikanische muslimische Institutionen seit den 1980er Jahren ziemlich effizient übernommen wurden, dürfen nicht ignoriert werden. Die von den Kommunisten unterstützte Palästina-Solidaritätskampagne, die 1982 in London gegründet wurde, und die Gründung des Palästina-Rückkehrzentrums in Großbritannien durch die Hamas (und damit der Bruderschaft) im Jahr 1986 sind ebenfalls wichtig.
Die BDS-Bewegung ist also eine rot-grüne Synthese, in der die Palästinenser die Aushängeschilder darstellen. Somit ist die Bewegung wohl nur die Vorhut eines viel größeren antiwestlichen Molochs, bei dem die Dialektik zwischen Kommunismus und Islam ungeklärt bleibt. So gesehen ist die palästinensische Sache von geringer Bedeutung, aber sie dient als Zugangsmittel, um dadurch Institutionen wie die Vereinten Nationen, internationale Arbeit, Kirchen und Bildungssysteme zu beherrschen. Gemeinsamer Antizionismus ist nur ein dünnes Feigenblatt für gemeinsamen Antisemitismus und Anti-Liberalismus sowie für Botschaften, die von ausgehöhlten westlichen Institutionen mit zunehmender Energie konsumiert werden.
Aber warum eine Internationalisierung? In der frühen Phase gab es noch den Vorteil von Ehrlichkeit in Bezug auf die Motive und das Publikum. Die panislamische und panarabische Rhetorik drückte fundamentale ethnische und religiöse Einwände gegen den jüdischen Nationalismus aus, was nicht nur den Mangel an lokalen nationalen Identitäten kompensieren sollte, sondern umgekehrt auch dazu beitrug, diese Identitäten zu erzeugen und zu definieren. Jüdischer Nationalismus und jüdische Souveränität trotzten der religiös bedingten muslimischen Vorherrschaft und imperialen ethnischen Ansprüchen, die eine arabische Herrschaft forderten. Aber der Preis der Internationalisierung war, dass arabische und später internationale Führer wichtige Hebel für die palästinensische Identität und Selbstbestimmung in die Hand bekamen, die für das Palästinathema zwar Lippenbekenntnisse gaben, aber andere Pläne verfolgten. Die arabische Politik war wiederum in Bezug auf Palästina an den Druck seitens der „arabischen Straße“ gebunden; durch Demagogie angetrieben, kann dadurch die lokale Führung unterstützt oder untergraben werden.
Darauffolgende Variationen der Internationalisierung verlagerten den palästinensischen Nationalismus in die aufkommenden internationalen Strömungen und Bewegungen: Nationalismus, Dritte Welt-Ideologie, internationaler Organisationismus, Menschenrechte sowie „Widerstand“ und Terrorismus. Nach und nach wurden Elemente davon in das palästinensische Nationalbewusstsein aufgenommen. Sie erhalten und definieren Palästina in einem Maße, wie es bei anderen ethno-nationalen Gruppen beispiellos ist. Teilweise auch weil sich der palästinensische Nationalismus gut zum latenten Antisemitismus fügt, wurde jede dieser Strömungen und Bewegungen auch wiederum zur palästinensischen Sache umgewandelt. Im Zuge dessen aber wurden ihre Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit untergraben.
Im Kern der palästinensischen Internationalisierung steht ein schwaches palästinensisches Nationalbewusstsein, das ständig der Unterstützung durch andere Probleme oder Rhetoriken bedarf. Palästinensischer Nationalismus ist sekundär oder reaktiv und entsteht theoretisch als Teil von größeren Nationalisierungsströmungen, aber meistens als negative Reaktion auf den Zionismus. Solange nicht positive Dimensionen entwickelt werden, die die Bewegung weiter bringen, als nur bis zu „Widerstand“, „Beharrlichkeit“ und Antisemitismus, wird die Internationalisierung der Palästinensersache wahrscheinlich noch anhalten.
Von Dr. Alex Joffe 26. November 2017
Alex Joffe ist Archäologe und Historiker. Er ist Shillman-Ginsburg Fellow am Middle East Forum.
BESA Center Perspectives Paper No. 656, 26. November 2017
Artikel Quelle: https://besacenter.org/perspectives-papers/palestinians-internationalization-means-ends/
Die Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) - Bewegung stellt sich als Graswurzelbewegung der palästinensischen Bemühungen zur Mobilisierung einer globalen Unterstützung gegen Israel dar. In Wahrheit ist sie aber eine lose koordinierte Bemühung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), der Muslimbruderschaft und der globalen Linken, die vorgibt, im Namen des palästinensischen Volkes zu sprechen. Im amerikanischen Jargon nennt man das „Astroturf” – eine künstliche Graswurzelbewegung.
Dieser jüngste Durchlauf der Bemühungen der palästinensischen Führungsschicht, ihren Konflikt mit den Juden, dem Zionismus und Israel zu internationalisieren, ist für ihre jahrhundertelange Bestrebung, die internationale Unterstützung anstelle und als Mittel zu einer Nationalisierung der palästinensischen Massen zu mobilisieren, emblematisch. Dabei verlor die palästinensische Führung jedoch die Kontrolle über diese Prozesse, die teilweise durch die politischen Bedürfnisse und den inhärenten Antisemitismus der arabischen und islamischen Länder sowie durch die globale Geopolitik angetrieben wurden.
Eine Internationalisierung war bereits in den 1920er Jahren, im frühen Stadium der pan-muslimischen und antikolonialen Politik, erkennbar. Auf die neu entstandene Narrative vom Jerusalemer Mufti Amin al-Husseini, dass die „al-Aqsa in Gefahr“ sei, folgte eine globale Spendenkampagne zur Restaurierung der Moscheen auf dem Tempelberg, durch die die angeblich von den jüdischen Übergriffen ausgehende Bedrohung noch hervorgehoben wurde. Als Präsident des Obersten Islamischen Rats inszenierte der Mufti die Unruhen an der Klagemauer im Jahr 1929 und eine islamische Konferenz, die 1931 in Jerusalem stattfand.
Der zu Beginn der Massengewalt von 1936-1939 vom Mufti inszenierte Generalstreik beinhaltete auch die Forderung nach einer arabischen Intervention. Obwohl deren Eintreten eher unwahrscheinlich war, waren die britischen Behörden von dieser Aussicht verunsichert, was die Verhängung des Kriegsrechts verhinderte, die Rebellen rettete und den Konflikt verlängerte. Kritik seitens Muhammad Ali Jinnah und seiner All-indischen Muslimliga hatte großen Einfluss auf Großbritannien.
Obwohl die Peel-Kommission, die infolge der palästinensischen Gewalt eingerichtet worden war, vorgeschlagen hatte, das Völkerbundsmandat zugunsten der Errichtung einer jüdischen nationalen Heimstatt in Palästina aufzugeben und das Land in zwei Staaten zu teilen – einen jüdischen und einen arabischen Staat – wurde die Idee vom Mufti strikt abgelehnt, der noch mehr zu tobender Gewalt aufrief. Die Bludan-Konferenz von 1937, an der so führende arabische nationalistische Gestalten wie Riad as-Solh von Libanon und Muhammad Ali Alluba Pasha aus Ägypten teilnahmen, war ein Ergebnis davon. Die Konferenz forderte einen Boykott gegen alle „jüdischen Güter und Aktivitäten“ sowie gegen die von Großbritannien. Darauf folgten eine zweite, geheime Konferenz von arabischen Nationalisten in Damaskus sowie weitere Konferenzen in Kairo und Brüssel im Jahr 1938. Bei all diesen Anlässen wurde die Palästinenserfrage viel diskutiert, aber sie diente vor allem als Instrument für andere nationalistische Bewegungen. Das Thema Palästina war sofort zentral und nominell.
Im Zeitalter des Panarabismus gab es ein ähnliches Zusammenspiel zwischen der Palästinafrage und den Bedürfnissen der arabischen Staaten. Bei der Gründung der Arabischen Liga im Jahr 1945 wurde das palästinensische Problem formell in den Mittelpunkt gestellt. Eine ihrer ersten Handlungen waren Boykotte gegen die Juden in arabischen Ländern, wo diese seit Jahrtausenden lebten. Eine weitere Bludan-Konferenz im Jahr 1946 enthielt einen Aufruf des Arabischen Hohen Komitees des Mufti an die arabischen Staaten, eine vereinte Armee zu bilden, um einen jüdischen Staat zu verhindern. Aber die arabischen Führer zögerten, bis sie durch den 1947 ausgebrochenen Bürgerkrieg zwischen den Palästinensern und Juden dazu gezwungen wurden. Es folgten eine militärische Intervention, Katastrophen, Schande und Enteignung.
Während der Phase des revolutionären Nationalismus stand hinter der Gründung der PLO im Jahr 1964 durch die Arabische Liga die palästinensische Bestrebung, den Konflikt durch eine Beteiligung von arabischen und muslimischen Verbündeten auszuweiten. Aber die treibende Kraft hinter der Gründung der Organisation war der ägyptische Präsident Gamal Abdul Nasser. Und es war der KGB, der nach 1967 Jassir Arafat und seine Fatah-Bewegung in die Führung der PLO manövrierte. Die Befreiung von Palästina durch „bewaffneten Kampf“ – der Euphemismus der PLO für Terrorismus (und in geringerem Maße für Guerillakrieg) – symbolisierte eine Form von magischem Denken, aber die „romantische“ Vorstellung eines revolutionären palästinensischen Nationalismus, der von externen Kräften geleitet und finanziert wird, prägte die palästinensische Nation und tat der Koexistenz mit Israel jahrzehntelang einen Abbruch.
Die Position der PLO während der Zeit der anti-imperialen und antikolonialen Kriegsführung war die einer grundlegenden Befreiungsbewegung. Sie verbündete sich mit dem Afrikanischen Nationalkongress, der SWAPO, den Sandinisten und einer Reihe anderer „indigener“ Bewegungen. Aber hinter diesen standen die Sowjetunion und ihre Satellitenländer, die für Ausbildung, Finanzierung und Unterstützung sorgten, und denen es im Wesentlichen um Stellvertreterkriege gegen die USA und ihre Verbündeten ging. Die palästinensische Sache stand rasch für die meisten Bewegungen im Mittelpunkt (ausgenommen Südafrika), während rund um Arafat und seinen engeren Kreis eine Kleptokratie entstand. Internationaler Terrorismus und blutige Kriege niedriger Intensität waren die primären Ergebnisse davon. Die West Bank und die Palästinenser in der Diaspora fielen auf eine nachgeordnete Stellung zurück, sogar noch nach den Oslo-Abkommen.
Eine weitere direkte Variante des Internationalisierungsprogramms war die Kooptation im System der Vereinten Nationen (UN), dem Herzstück des liberalen Internationalismus der Nachkriegszeit. Mit der Welle der Dritten-Welt-Ideologie, des Antiimperialismus und Antikolonialismus (Strömungen, die zum Teil von der Sowjetunion unterstützt wurden) schwimmend, und mit ausdrücklicher Unterstützung seitens der arabischen, muslimischen und kommunistischen Staaten, wurde die „Palästinafrage“ ab Mitte der 1960er Jahre zu einem zentralen Thema im UN-System.
Die UNRWA ist natürlich seit 1950 die Gesundheits-, Erziehungs- und Wohlfahrtsorganisation der Palästinenser, während zahlreiche andere Teile des UN-Systems moralische, rechtliche und praktische Unterstützung bieten. Die Unterstützung für die Palästinenser durch die Generalversammlung begann 1969 und 1970 mit der Resolution 2535, die „die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes bekräftigt“, und mit der Resolution 2672, in der gleichfalls von den palästinensischen „unveräußerlichen Rechten“ die Rede ist und durch die die „Palästinafrage“ auf die Tagesordnung der Generalversammlung von 1974 kam (wo sie bis heute geblieben ist).
Andere UN-Resolutionen sorgten für praktische Unterstützung: in der Resolution 3375 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation als „Vertreterin des palästinensischen Volkes“ anerkannt, mit der Resolution 3376 wurde das „Komitee zur Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes“ errichtet und die Resolution 3379 „bestimmt[e], dass Zionismus eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung ist“. Alle drei wurden 1975 am selben Tag verabschiedet. Durch die Resolution 3240 vom Jahr 1977 wurde die Sonderabteilung für die Rechte der Palästinenser im UN-Sekretariat ins Leben gerufen sowie der „Internationale Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk“. Umbenannt in „Abteilung für die Rechte der Palästinenser“, unterstützt diese Abteilung nun das „Komitee für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes“ durch internationale Treffen, Zusammenarbeit mit NGOs, Studien und Bulletins sowie Trainingsprogramme.
Unterstützung für die palästinensische Sache wird noch von mehr als 50 anderen Komitees oder Büros geboten, darunter der Sonderkoordinator für den Nahostfriedensprozess, der Sonderkoordinator in den besetzten Gebieten, Rückzugsbeobachter und Waffenstillstandskräfte, der Menschenrechtsausschuss und der Menschenrechtsrat, das Büro zur Koordinierung der humanitären Hilfe, der Jerusalem-Ausschuss, das Register der Vereinten Nationen für die Erfassung der durch den Bau der Mauer verursachten Schäden, der Sonderausschuss zur Untersuchung israelischer Praktiken, Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten und die Vermittlungskommission für Palästina, die 1948 gegründet wurde. Das absurde Ausmaß, in dem Palästina die UN dominiert, wird durch den vierten Ausschuss verdeutlicht, der sich mit „einer Vielzahl von Themen, die Entkolonialisierung, palästinensische Flüchtlinge und Menschenrechte, Friedenssicherung, Minenräumung, Weltraum, öffentliche Information, Atomstrahlung und die Universität für Frieden mit einschließen“ befasst.
Und schließlich, im Zeitalter der linkslastigen Anti-Globalisierung, gibt es auch noch die BDS-Bewegung. Sie ist angeblich ein Produkt der UN-Weltkonferenz über Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, die 2001 in Durban stattfand, der palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) von 2004 und des „Aufrufs der Palästinensischen Zivilgesellschaft zu BDS“ im Jahr 2005. Aber die wahren Ursprünge der Bewegung reichen mindestens bis in die 1940er Jahre zurück. Der Boykott der Arabischen Liga und der amerikanisch-arabische Antizionismus sind wichtige Grundlagen, ebenso wie die Beiträge des Generalverbandes der Palästinensischen Studenten (1959 in Kairo gegründet, damit Palästina zum Schwerpunkt des arabischen Studentenlebens im Nahen Osten und dann in Europa wird), aus dem dann im Jahr 2000 die Studentenorganisation „Studenten für Gerechtigkeit in Palästina“ hervorging.
Aber auch die Beiträge der Neuen Linken und insbesondere der jüdischen Linken der späten 1960er und 1970er Jahre (die teilweise vom KGB und der PLO genutzt wurden) und des amerikanischen Muslimbruderschaftsnetzwerks, von dem amerikanische muslimische Institutionen seit den 1980er Jahren ziemlich effizient übernommen wurden, dürfen nicht ignoriert werden. Die von den Kommunisten unterstützte Palästina-Solidaritätskampagne, die 1982 in London gegründet wurde, und die Gründung des Palästina-Rückkehrzentrums in Großbritannien durch die Hamas (und damit der Bruderschaft) im Jahr 1986 sind ebenfalls wichtig.
Die BDS-Bewegung ist also eine rot-grüne Synthese, in der die Palästinenser die Aushängeschilder darstellen. Somit ist die Bewegung wohl nur die Vorhut eines viel größeren antiwestlichen Molochs, bei dem die Dialektik zwischen Kommunismus und Islam ungeklärt bleibt. So gesehen ist die palästinensische Sache von geringer Bedeutung, aber sie dient als Zugangsmittel, um dadurch Institutionen wie die Vereinten Nationen, internationale Arbeit, Kirchen und Bildungssysteme zu beherrschen. Gemeinsamer Antizionismus ist nur ein dünnes Feigenblatt für gemeinsamen Antisemitismus und Anti-Liberalismus sowie für Botschaften, die von ausgehöhlten westlichen Institutionen mit zunehmender Energie konsumiert werden.
Aber warum eine Internationalisierung? In der frühen Phase gab es noch den Vorteil von Ehrlichkeit in Bezug auf die Motive und das Publikum. Die panislamische und panarabische Rhetorik drückte fundamentale ethnische und religiöse Einwände gegen den jüdischen Nationalismus aus, was nicht nur den Mangel an lokalen nationalen Identitäten kompensieren sollte, sondern umgekehrt auch dazu beitrug, diese Identitäten zu erzeugen und zu definieren. Jüdischer Nationalismus und jüdische Souveränität trotzten der religiös bedingten muslimischen Vorherrschaft und imperialen ethnischen Ansprüchen, die eine arabische Herrschaft forderten. Aber der Preis der Internationalisierung war, dass arabische und später internationale Führer wichtige Hebel für die palästinensische Identität und Selbstbestimmung in die Hand bekamen, die für das Palästinathema zwar Lippenbekenntnisse gaben, aber andere Pläne verfolgten. Die arabische Politik war wiederum in Bezug auf Palästina an den Druck seitens der „arabischen Straße“ gebunden; durch Demagogie angetrieben, kann dadurch die lokale Führung unterstützt oder untergraben werden.
Darauffolgende Variationen der Internationalisierung verlagerten den palästinensischen Nationalismus in die aufkommenden internationalen Strömungen und Bewegungen: Nationalismus, Dritte Welt-Ideologie, internationaler Organisationismus, Menschenrechte sowie „Widerstand“ und Terrorismus. Nach und nach wurden Elemente davon in das palästinensische Nationalbewusstsein aufgenommen. Sie erhalten und definieren Palästina in einem Maße, wie es bei anderen ethno-nationalen Gruppen beispiellos ist. Teilweise auch weil sich der palästinensische Nationalismus gut zum latenten Antisemitismus fügt, wurde jede dieser Strömungen und Bewegungen auch wiederum zur palästinensischen Sache umgewandelt. Im Zuge dessen aber wurden ihre Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit untergraben.
Im Kern der palästinensischen Internationalisierung steht ein schwaches palästinensisches Nationalbewusstsein, das ständig der Unterstützung durch andere Probleme oder Rhetoriken bedarf. Palästinensischer Nationalismus ist sekundär oder reaktiv und entsteht theoretisch als Teil von größeren Nationalisierungsströmungen, aber meistens als negative Reaktion auf den Zionismus. Solange nicht positive Dimensionen entwickelt werden, die die Bewegung weiter bringen, als nur bis zu „Widerstand“, „Beharrlichkeit“ und Antisemitismus, wird die Internationalisierung der Palästinensersache wahrscheinlich noch anhalten.
Von Dr. Alex Joffe 26. November 2017
Alex Joffe ist Archäologe und Historiker. Er ist Shillman-Ginsburg Fellow am Middle East Forum.
BESA Center Perspectives Paper No. 656, 26. November 2017
Artikel Quelle: https://besacenter.org/perspectives-papers/palestinians-internationalization-means-ends/